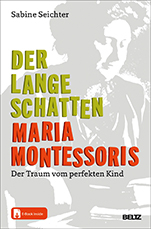 Dass Maria Montessoris esoterisches Theoriegebäude in ein kritisches Licht gerückt wird, ist aus Sicht einer sich selbst so bezeichnenden Erziehungswissenschaft notwendig. Leider ist es auch überfällig. Nachdem Rudolf Steiners Erziehungslehre bereits in den 1980ern mehrfach einer systematischen Kritik unterzogen wurde [1], gilt das für die der Dottoressa grosso modo erst seit der Jahrtausendwende [2]. Sabine Seichter moniert folglich, der „marode Zustand der erziehungswissenschaftlichen Forschungsliteratur [sei] für eine nüchterne Analyse freilich höchst erschwerend und geradezu peinlich“ (16). Diese Diagnose und dieser Duktus setzen den Grundton für die anschließende Kritik.
Dass Maria Montessoris esoterisches Theoriegebäude in ein kritisches Licht gerückt wird, ist aus Sicht einer sich selbst so bezeichnenden Erziehungswissenschaft notwendig. Leider ist es auch überfällig. Nachdem Rudolf Steiners Erziehungslehre bereits in den 1980ern mehrfach einer systematischen Kritik unterzogen wurde [1], gilt das für die der Dottoressa grosso modo erst seit der Jahrtausendwende [2]. Sabine Seichter moniert folglich, der „marode Zustand der erziehungswissenschaftlichen Forschungsliteratur [sei] für eine nüchterne Analyse freilich höchst erschwerend und geradezu peinlich“ (16). Diese Diagnose und dieser Duktus setzen den Grundton für die anschließende Kritik.
Kritisieren lässt sich jedenfalls hinreichend viel an dieser Pädagogik, die hierzulande, genau wie die Waldorfpädagogik, von der Privatisierung von Bildungseinrichtungen enorm profitiert und zugleich angesichts ihrer Entstehungs- und Erfolgsgeschichte sowie häufig selektiven Biographie ihrer Urheberin große Angriffsflächen bietet hinsichtlich ihrer Grundlegung und Legitimation. Mit dem Erscheinen von Seichters Band erfolgt eine gezielte Kritik an Montessoris „biopolitische[n] Visionen“ im „aktuellen Zusammenhang von Eugenik, Rassentheorie und Optimierungsstreben“, wie bereits der Klappentext ankündigt und somit den historisch-systematischen Problemhorizont des Werkes benennt. Seichter selbst beschreibt das Ansinnen des Bandes als „ideologiekritische[s] Bemühen, das eugenisch durchtränkte Denken Maria Montessoris nüchtern und analytisch nachzudenken“ (18); der gewählte Einfallswinkel ist, eingedenk Seichters Forschung und langjährigem Engagement in der entsprechenden DGfE-Kommission wenig überraschend, eine anthropologische Analyse.
Die Ausstattung, Aufmachung und der um Verständlichkeit bemühte Schreibstil unterstreichen das im Titel anklingende Ziel einer Entzauberung der Montessori-Pädagogik für ein breiteres Publikum hinsichtlich ihres eugenischen, biologistischen, mithin rassistischen Fundamentes. Es kommt zudem selten genug vor, dass ein Werk solchen Zuschnitts bei Erscheinen auf eine starke mediale Resonanz trifft und von Interviews u.a. in DLF Kultur, der FAZ und der NZZ begleitet wird [3]. Unterteilt ist das vorliegende Buch in fünf (nummerierte) Hauptkapitel und zwei weitere einrahmende ohne Nummerierung.
Vor dem ersten Kapitel führt Seichter in die „Glaubenswelten der Maria Montessori“ ein und skizziert die in Montessoris Werk so prävalente Melange aus positivistisch-naturwissenschaftlichem Optimierungsoptimismus und Entwicklungsdenken [4] sowie harmonistisch-„quasi-religiöse[n] Ansichten“ (8), inklusive ihrer Rezeption durch „die gleichermaßen unbedingte, unwissende und kritiklose Gefolgschaft“ (14). Seichter zieht eine Kontinuitätslinie von der damaligen Eugenik und deren Hoffnungen zu heutigen, technisch ermöglichten Kind- und Menschoptimieren im Zuge von Pränataldiagnostik, allseitiger Vermessung usw. Im „grenzenlose[n] Streben nach einem besseren Zustand der Menschheit“, das ist der vorweggenommene Schluss Seichters, läge „bis heute die Faszination für ‚Montessori‘“ (167) – eine These, die durch alternative Begründungen (Ablösung des Namens als Marke vom theoretischen Überbau und der pädagogischen Praxis gleichermaßen; wirksame Historiographie; pragmatische, milieugebundene Kita-/Schulwahl) zu irritieren wäre.
In den drei folgenden Hauptkapiteln umkreist in anschaulicher Manier Seichter den (bildungs-)historischen Kontext der Entstehung von Montessoris Programm: Die radikale Rationalisierung aller Lebensbereiche, die aufkommende ‚Rassenkunde‘ und die Hoffnung auf den neuen Menschen (mit leider nicht immer ausformulierten Anleihen aus post- und transhumanistischen Diskursen), die Affirmation dessen durch die Pädagogik und das veränderte Bild des normierten Kindes (und der Mutter). Das vierte Hauptkapitel bildet den quantitativen und qualitativen Schwerpunkt und ist ob der Übertitelung mit „Maria Montessori: Ganz Kind ihrer Zeit“ (70ff) einer Infragestellung ihres Heldinnen- bzw. Prophetinnenstatus gewidmet, ohne eine historische Relativierung zuzulassen – die zeitgenössische Kritik durch Dewey/Kilpatrick, der Fröbelianer wie auch Muchow kommt wohlinformiert zur Sprache.
Seichter zeigt, wie es allererst zu einer solchen Verehrung kommen konnte: Montessori bedient geschickt Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte im Italien um 1900, das an Unsicherheit generierenden Umbrüchen keinen Mangel leidet. Ohne Industrialisierung, Verstädterung und biopolitischer Normierung der Gesellschaft wäre Montessoris pädagogisches Versprechen der Komplexitätsreduktion und Optimierung bis hin zur Erlösung nicht zu verstehen. Die Autorin kombiniert in ihrer Argumentführung umfassende Entwicklungen und Beispiele (Weltausstellungen als Ausdruck kapitalistischer Steigerungslogik) mit historisch einflussreichen wissenschaftlichen Strömungen und Einzelpersonen, die für das Werk Montessoris zentral werden sollten und deren v.a. ästhetische Argumente als Iteration der Kalokagathie weitreichend Überzeugungskraft entfalten und die zugleich der pädagogischen Pädometrie und Quantifizierung Legitimation verschaffen (82ff). Besonders durch zahlreiche wörtliche Zitate rassenkundlicher Natur gelingt es Seichter, die Brutalität dieses Denkens zu demonstrieren und Montessoris Indifferenz demgegenüber zugunsten der Verbreitung ihrer ‚Methode‘ und ihres Namens zu rekonstruieren. Dass sie zu diesem Zweck „Schwachsinnige“ und „Idioten“ (teils gar als „Minderwertige“ oder „Parasiten“ markiert) einspannt, heute aber ihre Pädagogik als besonders inklusiv vermarktet wird, bildet nur eine Pointe der anhaltenden und Widersprüche ignorierenden Hagiographie Montessoris (134ff).
Das fünfte und (nicht nummerierte) sechste Kapitel dient einer Fokussierung auf das Denken und Handeln Montessoris durch die Brille foucaultscher Biomacht. Nicht nur lassen sich so zentrale Begriffe der Montessori-Pädagogik wie Normalität, Freiheit usw. in ihrer Sinnverdrehung entlarven, sondern zugleich eine Linie ziehen zu postmodernen Bestrebungen technischer Optimierung, die ihren „utopischen bzw. dystopischen Anstrich“ (151) verloren hat und selbst normalisiert wurde. Besonders mit Hinblick auf heutige Pränataldiagnostik wendet Seichter ihre Montessori-Kritik in eine mit großer moralischer Verve versehene Warnung wider die Naturalisierung anthropologischer Unterschiede, sowohl diskursiv wie biotechnologisch und – selbstverständlich – pädagogisch, etwa mit Blick auf die „sogenannte Bildungsselektion“ (163).
Was Sabine Seichter vorlegt, ist folglich nichts Geringeres als ein notwendiger Weckruf zur (Wieder-)Erlangung wissenschaftlicher Strenge bzgl. der Montessori-Pädagogik und ihren Implikationen bei aller Anerkennung der von ihren Ursprüngen und ihrer Namenspatronin emanzipierten Praktiken und Praxen. Konzeptuell stellt sich die Frage danach, womit sich Seichters Kritik mit ihrem starken anthropologischen Fokus relationieren oder gar stärken ließe, etwa in Hinblick auf die dem Konzept inhärente Ökonomisierungslogik, Praktiken der Verschleierung und andere strategisch-methodologische Einsätze, Montessoris Politizität, ihre Repräsentation reformpädagogischen Denkens usf.
Insgesamt, das soll bei allen kleinen bis mittleren Beanstandungen den Schlusspunkt dieser Besprechung bilden, ist es ein großes Verdienst Seichters die Notwendigkeit der Kritik an einer der Säulenheiligen unserer Disziplin anschaulich aufzuzeigen, auf aktuelle Diskussionen zu beziehen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Lektüre wird nicht nur dem pädagogischen Fachpersonal an entsprechenden Einrichtungen anempfohlen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die (wie der Rezensent selbst) während ihres Studiums im Modus einer zumeist unkritischen Lesart mit Maria Montessori und ihrer Pädagogik bekannt gemacht wurden.
[1] Prange, Klaus (1985): Erziehung zur Anthroposophie. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Ullrich, Heiner (1986): Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Weinheim: Juventa.
[2] Hofer, Christine (2001): Die pädagogische Anthropologie Maria Montessoris - oder: Die Erziehung zum neuen Menschen. Würzburg: Ergon. Leenders, Hélène (2001): Der Fall Montessori. Die Geschichte einer reformpädagogischen Erziehungskonzeption im italienischen Faschismus. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Fuchs, Birgitta (2002): Maria Montessori. Ein pädagogisches Porträt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt/UTB. Proske, Wolfgang (2005): Die Montessori-Pädagogik und ihre weltanschaulichen Grundlagen. In: Forum Demokratischer AtheistInnen (Hrsg.): Mission Klassenzimmer. Zum Einfluss von Religion und Esoterik auf Bildung und Erziehung. Aschaffenburg: Alibri. Böhm, Winfried (2010): Maria Montessori. Einführung mit zentralen Texten. Paderborn: Schöningh. Reiß, Marcus (2012): Kindheit bei Maria Montessori und Ellen Key. Disziplinierung und Normalisierung. Paderborn: Schöningh.
[3] https://www.deutschlandfunkkultur.de/buch-ueber-reformpaedagogin-der-lange-schatten-der-maria-montessori-dlf-kultur-025b412f-100.html; https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/maria-montessori-von-inklusion-kann-keine-rede-sein-19539048.html; https://www.nzz.ch/wissenschaft/maria-montessori-vertrat-rassistische-und-eugenische-denkweisen-ld.1814423 .
[4] Vgl. Buck, Marc Fabian (2016): Vorsicht Stufe! Zur Kritik von Entwicklungsmodellen des Menschen in der Pädagogik. Diss. phil., HU Berlin. https://doi.org/10.18452/17436. Hier: 55ff.
