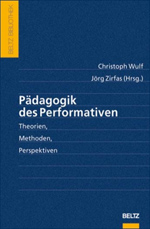 Die BeschĂ€ftigung mit dem Performativen verspricht seit einiger Zeit auch im Rahmen erziehungswissenschaftlicher Reflexion den Gewinn neuer Perspektiven und Fragestellungen. Der unter dem Titel âPĂ€dagogik des Performativenâ herausgegebene Band geht diesem Versprechen nach und versammelt eine groĂe Zahl an AufsĂ€tzen. Wie fruchtbar die BeschĂ€ftigung mit dem Performativen sein kann, zeigt sich an der Bandbreite der behandelten Themen. Diese erstreckt sich von Filmreflexionen ĂŒber Fragen der Geschlechterforschung und Jugendkulturforschung hin zu grundlagentheoretischen Ăberlegungen â um nur einige Schlaglichter zu werfen.
Die BeschĂ€ftigung mit dem Performativen verspricht seit einiger Zeit auch im Rahmen erziehungswissenschaftlicher Reflexion den Gewinn neuer Perspektiven und Fragestellungen. Der unter dem Titel âPĂ€dagogik des Performativenâ herausgegebene Band geht diesem Versprechen nach und versammelt eine groĂe Zahl an AufsĂ€tzen. Wie fruchtbar die BeschĂ€ftigung mit dem Performativen sein kann, zeigt sich an der Bandbreite der behandelten Themen. Diese erstreckt sich von Filmreflexionen ĂŒber Fragen der Geschlechterforschung und Jugendkulturforschung hin zu grundlagentheoretischen Ăberlegungen â um nur einige Schlaglichter zu werfen.
Im einleitenden Artikel der beiden Herausgeber wird bereits im Untertitel das Versprechen einer ZusammenfĂŒhrung erziehungswissenschaftlicher und performativitĂ€tstheoretischer Reflexionen angesprochen: Nichts weniger als â[e]in neuer Fokus erziehungswissenschaftlicher Forschungâ (7) eröffne sich durch diese ZusammenfĂŒhrung. Die Herausgeber (und mit ihnen ein GroĂteil der versammelten Autor/innen) können dabei auf eigene Arbeiten im Rahmen der BeschĂ€ftigung mit Mimesis und Ritual zurĂŒckgreifen, an die das PerformativitĂ€tstheorem hohe AnschlussfĂ€higkeit besitze. So wird auch ĂŒber (fast) die gesamte Breite des Bandes hinweg das einleitend dargestellte VerstĂ€ndnis von PerformativitĂ€t als inszenierendes und auffĂŒhrendes Geschehen geteilt (16f.). Die bildungstheoretische Relevanz einer solchen Perspektive bestehe, so die Herausgeber, einerseits in der Offenlegung eben jener inszenierenden Momente pĂ€dagogischen Geschehens (18) und andererseits in der Legitimierung qualitativer ForschungszugĂ€nge (20). âBildungâ wird dabei als klassisch individualisierendes Geschehen im Rahmen von sich Ă€ndernden Welt-, Selbst- und SozialbezĂŒgen des Menschen verstanden (29). Deren AuffĂŒhrung verknĂŒpfe sich mit mimetischen und ereignishaften Momenten â was die auĂerordentliche Reichweite der performativen Perspektive demonstriere: âDas fĂŒr performative Handlungen relevante praktische Wissen ist körperlich und ludisch sowie zugleich historisch und kulturell; es bildet sich in face-to-face Situationen und ist semantisch nicht eindeutig; es hat imaginĂ€re Komponenten, lĂ€sst sich nicht auf IntentionalitĂ€t reduzieren, enthĂ€lt einen BedeutungsĂŒberschuss und zeigt sich in rituellen Inszenierungen und AuffĂŒhrungen von PĂ€dagogik, Religion, Politik und alltĂ€glichem Lebenâ (32). Angesichts der hier angedeuteten Breite des Konzepts stellt sich allerdings die Frage, worin die Besonderheit des PerformativitĂ€tstheorems liegt und wie der Begriff der âPerformativitĂ€tâ vom Begriff der Handlung und auch des Rituals abzugrenzen wĂ€re. Kurz: Worin besteht das Spezifische und das Neue des performativen Fokus?
Die meisten der unter den verschiedenen Themenbereichen âĂsthetische und soziale Bildungâ, âIdentitĂ€tsbildungâ, âInstitutionelle und virtuelle Bildungâ sowie âPerformative Ethnographieâ versammelten Arbeiten stellen dann auch den Anschluss ihrer eigenen Arbeiten zum PerformativitĂ€tstheorem her â und ermöglichen auf diesem Wege das Abschreiten einer thematischen Breite, wie sie unter anderen Foki kaum zu bieten wĂ€re. Unter anderem zeigt Birgit Althans anhand empirischer Forschungen zu verschiedenen religiösen Praktiken Berliner Jugendlicher die spezifische Wirklichkeitsdimension praktischer VollzĂŒge auf (vgl. v.a. 166ff.).
Die Wirklichkeit konstituierende Dimension des Performativen wird auch im Aufsatz Benjamin Jörissens zum zentralen Fokus anhand des Beispiels virtueller Spielergemeinschaften. Die Fruchtbarkeit des performativen Blickwinkels gegenĂŒber rein handlungstheoretisch oder interaktionistisch gelagerten Konzepten zeigt sich hier insbesondere an der AnschlussfĂ€higkeit an medientheoretische Ăberlegungen: âMan vollzieht etwas im Gebrauch der Bilder. Dabei erweist sich jedes auf dem Bildschirm erscheinende Bild bei genauer Betrachtung als unmittelbar mit pragmatischen VollzĂŒgen verknĂŒpft, denn jedes Bild entsteht unmittelbar als Ergebnis eines Amalgams, im welchem die Handlungen des Benutzers, die semiotischen Anweisungen der bildhaften âBenutzeroberflĂ€cheâ und die bilderzeugenden digitalen Operationen des Computers miteinander verschmolzen sindâ (193f.).
Herauszuheben sind die im letzten Abschnitt des Bandes unter dem Stichwort âPerformative Ethnographieâ versammelten Ăberlegungen, die sich in besonderem MaĂe den Konsequenzen einer performativitĂ€tstheoretischen Perspektive widmen. So stellt Bohnsack in seinen methodologischen Ăberlegungen fest, dass âPerformativitĂ€t ⊠nicht primĂ€r ein Darstellungsmodus, eine Metapher des Theatralischenâ darstelle. Vielmehr sei in Erweiterung der Arbeiten der Herausgeber eine âanalytische Differenzierung und die entsprechende empirische Rekonstruktionâ (204) der von Bohnsack im RĂŒckgang auf die Mannheimsche Soziologie entwickelte Doppelstruktur von Handeln zu leisten. Bohnsack selbst sieht vor allem in der Differenz von PerformativitĂ€t und Performanz die Differenz von Struktur und Prozess angelegt, die fĂŒr seine Fokussierung auf methodologische Konsequenzen hinsichtlich rekonstruktiver Verfahren empirischer Sozialforschung interessant wird (vgl. 207f.).
Dass PerformativitĂ€t nicht eine alternative Perspektive darstelle, sondern vielmehr gĂ€ngige Konzepte von Handlung, Subjekt und nicht zuletzt auch Fragen des Theoretisierens selber affiziert, wird von Forster ĂŒberzeugend dargestellt. Forster arbeitet heraus, dass damit nichts weniger als die Möglichkeit von Kritik befragt wird und damit die Grundlage jedes theoretischen SelbstverstĂ€ndnisses ĂŒberhaupt (vgl. v.a. 234f.). Andrea Bramberger kann dies in ihrem Aufsatz ausgehend von Fragen des doing gender und mit Bezug auf Haraways Konzept des âsituierten Wissensâ ebenfalls aufzeigen und folgendermaĂen resĂŒmieren: âDie Kernaussage lautet: PerformativitĂ€t erfasst uns in der Theoriebildung mit. PerformativitĂ€t lĂ€sst sich einerseits beobachten, andererseits sind Beobachten und Schreiben performative Akteâ (104).
Dem Band gelingt es insgesamt, die Aufgeschlossenheit verschiedener erziehungswissenschaftlicher ForschungsstrĂ€nge fĂŒr die Dimension des Performativen aufzuzeigen. Die Sprengkraft des Performativen wird insbesondere durch die âProduktion von Theorieâ und damit auch deren Platzierung und SelbstverstĂ€ndigung greifbar, wobei jedoch Teile der Diskussion um PerformativitĂ€t vom GroĂteil der Autorinnen ausgespart werden. Die Breite möglicher AnschlĂŒsse gerĂ€t allerdings dort zum Nachteil, wo der âneue Fokusâ gegenĂŒber anderen Konzepten Berliner Provenienz, z.B. Mimesis oder Ritual, ununterscheidbar wird. Da jedoch die AufsĂ€tze â bis auf den Herausgeberbeitrag zu Beginn â stets nicht mehr als ca. 10 Seiten (!) umfassen, scheint ein editorischer Rahmen fĂŒr die kursorische KĂŒrze mitverantwortlich zu sein. Zu bedauern ist auĂerdem, dass Ăberlegungen ausbleiben, welche die BeitrĂ€ge zueinander in ein VerhĂ€ltnis setzen. Anregungen, sich dem Performativen und dessen Konsequenzen fĂŒr erziehungswissenschaftliches Denken zu widmen, werden in und durch den Band allemal gegeben.
