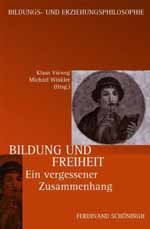 Der Tagungsband „Bildung und Freiheit – Ein vergessener Zusammenhang“ ist das Ergebnis der internationalen Tagung „Bildung und Freiheit“, welche im September 2010 durch die fachübergreifende Forschergruppe „Bildung zur Freiheit – Zeitdiagnose und Theorie im Anschluss an Hegel“ an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ausgerichtet worden ist. Er versammelt unter drei disziplinär abgrenzbaren Perspektiven (Pädagogik/Erziehungswissenschaft, Philosophie, Rechtswissenschaft – Soziologie – Politikwissenschaft) die Beiträge der Tagungsteilnehmer/innen und bietet dadurch einen interdisziplinären Zugang zu einem Schwerpunkt des Bildungsdiskurses, der gegenwärtig nur selten zur Sprache kommt: Es geht um den „weitgehend vergessenen bzw. marginalisierten Zusammenhang der Begriffe Bildung und Freiheit“ (9) und dessen Bedeutung für die Erschließung eines modernen Bildungsbegriffes, der sich gegenwärtig und zukünftig stellenden Anforderungen genügen können soll. Die Autoren/innen des Tagungsbandes – Professoren/innen und Dozenten/innen an europäischen, südkoreanischen und US-amerikanischen Universitäten – wollen diesem Zusammenhang aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Blickwinkeln gerecht werden: Es sollen gehaltvolle Bildungsdebatten eröffnet werden, die einen souveränen lösungsorientierten Umgang mit Problemfeldern moderner Gesellschaften ermöglichen. Disziplinübergreifend wird dabei „Hegels elaborierte Bildungstheorie“ (Klappentext) zum Maßstab.
Der Tagungsband „Bildung und Freiheit – Ein vergessener Zusammenhang“ ist das Ergebnis der internationalen Tagung „Bildung und Freiheit“, welche im September 2010 durch die fachübergreifende Forschergruppe „Bildung zur Freiheit – Zeitdiagnose und Theorie im Anschluss an Hegel“ an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ausgerichtet worden ist. Er versammelt unter drei disziplinär abgrenzbaren Perspektiven (Pädagogik/Erziehungswissenschaft, Philosophie, Rechtswissenschaft – Soziologie – Politikwissenschaft) die Beiträge der Tagungsteilnehmer/innen und bietet dadurch einen interdisziplinären Zugang zu einem Schwerpunkt des Bildungsdiskurses, der gegenwärtig nur selten zur Sprache kommt: Es geht um den „weitgehend vergessenen bzw. marginalisierten Zusammenhang der Begriffe Bildung und Freiheit“ (9) und dessen Bedeutung für die Erschließung eines modernen Bildungsbegriffes, der sich gegenwärtig und zukünftig stellenden Anforderungen genügen können soll. Die Autoren/innen des Tagungsbandes – Professoren/innen und Dozenten/innen an europäischen, südkoreanischen und US-amerikanischen Universitäten – wollen diesem Zusammenhang aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Blickwinkeln gerecht werden: Es sollen gehaltvolle Bildungsdebatten eröffnet werden, die einen souveränen lösungsorientierten Umgang mit Problemfeldern moderner Gesellschaften ermöglichen. Disziplinübergreifend wird dabei „Hegels elaborierte Bildungstheorie“ (Klappentext) zum Maßstab.
Im grundlegend metaphysischen Zugang des Werkes liegt seine Bedeutung für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs; denn die Autoren erinnern daran, dass allen Bildungsdebatten ein klar bestimmter, wissenschaftlicher Bildungsbegriff zu Grunde liegen muss, hierbei aber gerade auch aus erziehungswissenschaftlicher Sicht empirische Überprüfbarkeit als alleiniges Kriterium von Wissenschaftlichkeit nicht genügt. Wenn Bildung sinnvoll von Begriffen wie Ausbildung oder Sozialisation abgegrenzt werden soll, so gilt weiterhin, dass sie nicht nur im Sinne einer Vermittlung von Wissensinhalten oder kulturellen Konventionen bestimmt werden darf, sondern dass gleichwertig dem menschlichen Streben nach Individualität, nach (Willens-)Freiheit und Selbsterkenntnis als Phänomenen menschlicher Entwicklung und Wirklichkeit, Rechnung getragen wird [1]. Die meisten Beiträge des Tagungsbandes greifen mithin ein neuhumanistisches Bildungsverständnis in dem Sinne auf, dass die Entwicklung des Individuums weder gesellschaftspolitischen noch ökonomischen Interessen untergeordnet werden darf, und kontrastieren es mit gegenwärtigen Bildungskonzeptionen, die tendenziell als inhaltsleer oder irreführend charakterisiert werden. So fragt Michael Winkler streitbar, ob Bildung momentan nicht eher die Gefahr der „Entmündigung“ (11ff) in sich berge. Er kritisiert den inflationären Gebrauch des Begriffs „Bildung“, der „nur noch einen Diskursmarker“ (15) darstelle, wobei „die hohe semantische Aufladung des Bildungsbegriffes zu seiner eigenen Vernichtung beiträgt“ (16). Bildung wird nach Winkler zum sozialen Heilsversprechen und zur standardisierten gesellschaftlichen Anforderung an die Funktionalität des Einzelnen. Mit der „Reflexion des Subjekts“ (13) habe sie dabei „nichts mehr zu tun“ (13); denn zunehmend werde sie von metaphysischen Einsichten entkoppelt und „an Steuerung und Messung geknüpft, die sich an sogenannten [sic] Standards orientieren“ (13). Was heute unter Bildung verstanden wird, ziele demnach nicht mehr auf freien Willen und Selbsterkenntnis, sondern werde zunehmend zu einem Durchlaufen verschiedener institutionalisierter Prüfungsstufen. Diese Bildung, die in Form von Nachweisen erworben werden kann, werde teilweise zur Ware. Das trage zur Zertifizierung des Menschen bei, ermögliche ihm aber kaum mehr eine souveräne Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt.
Wiewohl Winklers Analyse der heutigen Bildungssituation stellenweise etwas drastisch wirken mag, legt sie doch ein grundlegendes Problem offen: Werden Lerninhalte zunehmend standardisiert und funktionalisiert oder durch formelle Anforderungen ersetzt, trägt das unter Umständen nicht zur Mündigkeit, sondern zur Uniformierung der Subjekte bei. Unter solchen Umständen wird der Lernende kaum zu einer kritischen Distanz gegenüber gegenwärtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten ermutigt, da er nicht viel mehr als eine Ausbildung erfährt, die eine Anpassung an eben jene Gegebenheiten zum Maßstab für Gelingen und Scheitern erhebt.
Hans-Peter Müller analysiert diese Dynamiken aus soziologischer Perspektive und bringt das Problem als „Bildung ohne Bildung“ (223) sprachlich auf den Punkt. Dieses Paradox birgt für den Bildungssuchenden offensichtlich ein erhebliches Frustrationspotenzial in sich, nicht zuletzt weil Bildung eigentlich, wie sich bei Ralf Beuthan zeigt, im Kern eine Fortentwicklung im Kontrast zum Verfall benennen sollte (101 ff). Auch Reinhard Mehring weist auf die Gefahren für das kritische und wissenschaftliche Denken hin, die sich aus einer Überbetonung von Bildung als bloßer Wissensvermittlung ergeben können, hofft aber auf die „kompensatorisch[e]“ Wirkung der „neuhumanistische[n] Vision vom freien Geist“ (41). Dabei verklärt er das neuhumanistische Bildungsideal keineswegs. Vielmehr zeigt er, dass es zur Definition eines modernen Bildungsbegriffes zwar beitragen, diesem aber nicht genügen kann. Einem rein „kopflastig[en]“ (39) Bildungsbegriff kann er nichts abgewinnen und betont, dass „die Anforderungen der Berufswelt [heute] auch ein Thema der Schulen sein [müssen]“ (34). Gleichzeitig müsse aber auch dem „reflexiven Selbstverständnis des Menschen“ (41) Genüge getan werden. Dafür hält Mehring eine kritische Rückbesinnung auf den humanistischen Bildungsbegriff für hilfreich.
Claudia Wirsing weist den Verlust an klaren Begrifflichkeiten und eindeutig definierten Inhalten als grundlegendes Problem unserer gegenwärtigen Gesellschaft aus, „die keine allgemeingültigen und gesicherten Deutungen mehr aufweist, sondern, in unendlicher Kommunikation erstickt, ein verbindliches Selbstverständnis ihrer Strukturen verhindert“ (52). Die Entleerung des Bildungsbegriffes zeigt sich so als nur ein Aspekt eines soziokulturellen Phänomens: Des allmählichen gesamtgesellschaftlichen Verlusts der Möglichkeit auf wahre Freiheit und Mündigkeit. Dabei ist das mündige Subjekt Grundlage freiheitlicher demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Johanna Hopfner und Klaus Vieweg weisen mit Hegel darauf hin, dass „die Geltung des Rechts […] auf dem denkenden Bewusstsein der Menschen selbst [beruht]“ (57) und dass Bildung „in ihrer ‚absoluten Bestimmung‘ […] der einzig mögliche Weg zur Konstitution der Freiheit [ist]“. Eberhard Eichenhofer und Ingo Richter unterstreichen aus rechtswissenschaftlicher Sicht die Dringlichkeit des Problems, indem sie Bildung zur Mündigkeit als „soziales Menschenrecht“ (165ff) betonen.
Einige weitere Beiträge des Tagungsbandes setzen sich nur marginal mit der Problembestimmung von Bildung in ihrer Verkehrung sowie rhetorischen Entleerung auseinander. Die transdisziplinäre Ausrichtung des Werkes geht notwendig mit einer gewissen Themen- und Erkenntnisvielfalt einher. Die erziehungswissenschaftliche Bedeutung von „Bildung und Freiheit – Ein vergessener Zusammenhang“ soll hier aber betont werden; denn die Autoren und Autorinnen nehmen sich mit der Bildung eines Gegenstandes an, der die Pädagogik unbedingt angeht, mit dem sie aber aktuell schwer umzugehen weiß. Eine verwirrende Vielzahl willkürlicher oder unklarer Bildungsbegriffe bzw. die Entfremdung des erziehungswissenschaftlichen Diskurses durch den Rückzug auf soziologische Begriffsbestimmungen [2] sind für diese Verunsicherung ebenso symptomatisch, wie Tendenzen zu einem verengten „politisch wirksamen kritischen Bildungsbegriff“ [3]. Die Verzahnung des Bildungsbegriffes mit dem Begriff der Freiheit rückt hinsichtlich dessen einen wichtigen Aspekt in den Vordergrund: Um über Bildung sinnvoll sprechen zu können, müssen wir zum einen über einen klaren Bildungsbegriff verfügen, und diesen zum anderen in einen deutlichen und konsequent erziehungswissenschaftlichen Begriffszusammenhang setzen können. Der These der Autor/innen, dass Bildungsdebatten sich dabei nicht auf Überlegungen zur Wissensvermittlung im Zeichen einer Gesellschafts- und Wirtschaftsoptimierung zurückziehen dürfen, sondern vorrangig die Problematik der Menschwerdung behandeln sollten, ist insofern zuzustimmen, als Menschwerdung sich nicht nur intellektuell, sondern auch moralisch, ästhetisch, im freien Willen begründet. Bildung so verstanden kommt ohne das Element des Metaphysischen nicht aus; der Begriff weist über den Bereich des klar Messbaren hinaus. Eine Verkürzung des wissenschaftlichen Zugangs auf eine quantitative Erschließung muss notwendig von einer zufriedenstellenden Annäherung an den Bildungsbegriff wegführen. Ebenso wenig darf allerdings aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive das Problem der „empirischen Anschlussfähigkeit“ [4] vernachlässigt werden. Die drängende Frage nach der Vereinbarkeit von bildungstheoretischen Überlegungen und empirischer Bildungsforschung wird leider auch im vorliegenden Band wenig diskutiert; hier wären weiterführende Überlegungen wünschenswert gewesen.
Die Autoren/innen tragen ihre Kritik an der Entfremdung des Bildungsbegriffes leidenschaftlich, teilweise polemisch vor. Das Plädoyer für eine Rückbesinnung auf die metaphysische Prägung des Bildungsbegriffes steht dabei deutlich im Vordergrund. Dadurch wird mitunter fälschlich der Eindruck erweckt, der gegenwärtige erziehungswissenschaftliche Bildungsdiskurs sei weitestgehend frei von zukunftsweisenden Lösungsansätzen, und quantitative Ansätze der Bildungsforschung seien vor allem irreführend. In dieser Hinsicht wirkt die Ausrichtung des Werkes nicht ganz ausgewogen. Nichtsdestotrotz ist das Plädoyer vor dem Hintergrund der genannten Dilemmata, welche den aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskurs um Bildung prägen, nachvollziehbar und die Kritik verdient Gehör. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihr könnte einen Beitrag zur Differenzierung der aktuellen Bildungsdebatten leisten.
[1] Vgl. u.a. Grunert, C.: Bildung und Kompetenz – Theoretische und empirische Perspektiven auf außerschulische Handlungsfelder, VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer VS, Wiesbaden 2012, 28 ff
[2] vgl. Bock, K.: Einwürfe zum Bildungsbegriff. In: Otto/Rauschenbach (Hrsg.): Die andere Seite der Bildung – Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, 91-105, 93
[3] Andresen, S.: Bildungstheoretische Überlegungen im Kontext der Wissensgesellschaft. In: Otto/Rauschenbach (Hrsg.): Die andere Seite der Bildung – Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, 133-144, 134
[4] Grunert, C: Bildung und Kompetenz, a.a.O., 12
