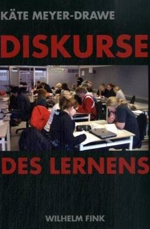 Die Erforschung von Lernprozessen gilt gemeinhin als eine Domäne der Psychologie und der neurowissenschaftlichen Hirnforschung. Wer immer fragt, wie Lernen funktioniert und wie Lernprozesse gesteuert und verbessert sowie effizienter und effektiver gestaltet werden können, wendet sich heutzutage an Kognitionspsychologen und Hirnforscher, nicht aber an Pädagogen und Philosophen. Die Monographie von Käte Meyer-Drawe unterbreitet all denen ein profund vorgetragenes Angebot, denen die Auskunft, dass unser Gehirn eine uns mit autopoietisch konstruierten Entwürfen von unserer Wirklichkeit versorgende neuronale Informationsverarbeitungsmaschine ist, nicht genügt, weil diese Auskunft so wenig zu dem passt, wie wir uns selbst und unser Lernen erfahren. Es gibt Dimensionen des Lernens, die für vernunftbegabte Naturwesen, die wir nun einmal sind, nicht suspendierbar sind – auch wenn der derzeit dominierende Lerndiskurs sie ausblendet und vergessen macht.
Die Erforschung von Lernprozessen gilt gemeinhin als eine Domäne der Psychologie und der neurowissenschaftlichen Hirnforschung. Wer immer fragt, wie Lernen funktioniert und wie Lernprozesse gesteuert und verbessert sowie effizienter und effektiver gestaltet werden können, wendet sich heutzutage an Kognitionspsychologen und Hirnforscher, nicht aber an Pädagogen und Philosophen. Die Monographie von Käte Meyer-Drawe unterbreitet all denen ein profund vorgetragenes Angebot, denen die Auskunft, dass unser Gehirn eine uns mit autopoietisch konstruierten Entwürfen von unserer Wirklichkeit versorgende neuronale Informationsverarbeitungsmaschine ist, nicht genügt, weil diese Auskunft so wenig zu dem passt, wie wir uns selbst und unser Lernen erfahren. Es gibt Dimensionen des Lernens, die für vernunftbegabte Naturwesen, die wir nun einmal sind, nicht suspendierbar sind – auch wenn der derzeit dominierende Lerndiskurs sie ausblendet und vergessen macht.
Das Buch von Käte Meyer-Drawe ist zweifellos die wichtigste Veröffentlichung zum Begriff des Lernens aus pädagogischer Sicht der letzten Jahre. Zwar entwickelt die Autorin keine umfassende und systematische Theorie des Lernens, doch die Konturen einer Alternative zur dominierenden kognitionspsychologischen und neurowissenschaftlich-konstruktivistischen Lerntheorie treten deutlich hervor. Anstatt einem enzyklopädischen Bedürfnis nachzugeben, wird das Lernthema aus einer phänomenologischen Sicht auf die Welt entfaltet. Anders als der Buchtitel zu versprechen scheint, werden nicht unterschiedliche Diskurse des Lernens ausgebreitet. Vielmehr ist es ein von der Phänomenologie Bernhard Waldenfels’ und Maurice Merleau-Pontys, aber auch von Platon inspirierter Diskurs, der das Buch durchzieht, nicht wie ein roter Faden, sondern vielmehr wie eine Mehrzahl von Fäden, deren lose Enden immer wieder aufgegriffen werden.
Das Buch ist in sieben umfangreiche Kapitel ohne weitere Untergliederungen eingeteilt. Dabei ist das erste Kapitel „Diskurse des Lernens“ wie eine Einleitung zu lesen. Ein Schlusskapitel, in dem die Erträge des Buches in konzentrierter Form festgehalten werden, gibt es nicht. Ausgehend von den thematischen Einstiegen zu Beginn der Kapitel wird der Leser auf verschlungene Nebenpfade mal vorwärts, mal rückwärts geleitet und gerät irgendwann an anderer Stelle zum Hauptstrang zurück. Dabei kehren bestimmte Themen, Positionen und Gegenpositionen wieder. Die Kernthese des Buches lautet dabei: „Lernen ist in pädagogischer Perspektive und in strengem Sinne eine Erfahrung“ (15).
Unter der Überschrift „Der neue Mensch“ wird im zweiten Kapitel die Rolle thematisiert, die die Entwicklung einer Technologie des Lernens für die Erschaffung des anderen, des „neuen“ Menschen hat. So sei die „Selektion der unbrauchbaren Elemente, Verstärkung des passenden Verhaltens“ das Merkmal unserer Zeit (45). Dem entspreche eine Auffassung des Lernens als eines möglichst glatt verlaufenden, störungsfreien und inhaltlich nicht weiter bestimmten Prozesses, für den der „Lerner“ selbstverständlich selbst verantwortlich sei. Der moderne Lerner – so die Utopie – werde durch Lernen zum Schöpfer seiner selbst. Für die Entwicklung einer brauchbaren Technologie des Lernens habe das Verständnis des Gehirns und seiner Arbeitsweise von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt – so sehr, dass nicht selten Aktivitäten des Gehirns mit Vorgängen wie „Wahrnehmen“ und „Lernen“ umstandslos gleichgesetzt worden seien: Lernen findet dort statt, wo mit Hilfe bildgebender Verfahren erhöhte Hirnaktivitäten festgestellt werden.
Die Autorin arbeitet die neuzeitlich technologische Fassung des Menschen zunächst als körperliche, dann als geistige Maschine heraus. Bei der Rekonstruktion des technologischen Lernprogramms wird eine Linie von den Philanthropen über die Reformpädagogik und den Behaviorismus bis zur Hirnforschung gezogen. Hier findet sich auch ein Exkurs zur Haltung der Phänomenologie zur Technik. Meyer-Drawe hält Positionen, die Technik und Maschinen als Ausdruck menschlichen Herrschaftswillens betrachten, entgegen, dass Menschen keine Maschinen seien. Vielmehr seien die Maschinen Verkörperungen von Idealen, denen wir selbst anhängen. Als Resümee dieses Kapitels darf das vorangestellte Nietzsche-Zitat gelesen werden: Wer den höheren Menschen anstrebt, muss damit rechnen, dass das, was er erreicht, Übermensch und Unmensch zugleich ist.
Gegenstand des dritten Kapitels („Die neuronale Maschine“) sind die Verwechslungen, die aufgrund der naiven Gleichsetzung von Beobachtungen am Gehirn mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen entstehen. Unmissverständlich heißt es, dass es ein neuronales Korrelat zu unseren Erfahrungen genauso wenig gebe wie ein physiologisches Pendant zur Liebe (74). Um die Bilder, die mit bildgebenden Verfahren gewonnen werden, interpretieren zu können, sind die Versuchsleiter auf die Interpretationen ihrer Probanden angewiesen. Ihre lebensweltlichen Beschreibungen stellen die sinngebenden Bezugspunkte bildgebender Verfahren dar. Diese Abhängigkeit wird aber ignoriert, wenn Menschen sich als Maschinen deuten.
Mit dem Wandel der Maschinen verändern sich auch die Selbstdeutungen der Menschen als Maschinen. Solche Deutungen fänden sich schon bei Descartes, der bereits Tiere als Maschinen und den Verstand als geistigen Apparat gesehen habe. Erwähnung finden auch Pascal, Leibniz, LaMettrie und unter den Pädagogen Comenius, Pestalozzi und Basedow. Das Menschenbild wandelt sich mit dem Aufkommen der Dampfmaschinen, durch die der Kraftbegriff und Vorstellungen der Regulierung bedeutsam wurden, die beispielsweise in Freuds psychodynamischer Theorie eine große Rolle spielen. Mit der Informationstechnologie stellt sich der Mensch als kybernetische Maschine vor, heute als ein neuronales Netzwerk.
Immer schon greift der pädagogische Diskurs die dominanten Vorstellungen seiner Zeit bereitwillig auf und begeht damit die gleichen kategorialen Fehler, wie diejenigen Neurowissenschaftler, die aus ihren Forschungen über das Gehirn Folgerungen für das menschliche Lernen ziehen. Es ist eine Stärke des Buches von Meyer-Drawe, den Unterschied zwischen dem, was man auf Bildern über Gehirnaktivitäten sieht, und dem, was man meint, wenn man von Lernen und Erfahrungen spricht, immer wieder herauszustellen: Gehirne sind nicht die Subjekte des Lernens. Was wir denken, wenn wir denken, kann uns kein Bild unserer Gehirnaktivitäten zeigen (93). Diese Absage an reduktionistische Positionen gibt den Weg für eine Behandlung des Lernens jenseits des dominanten, von den Naturwissenschaften geprägten Diskurses frei. Lernen fängt mit Schwierigkeiten an, ist eine Antwort auf Störungen, die von den Dingen ausgehen und nicht von uns. Lernen ist eine Erfahrung, die bereits ein Wissen von der Welt voraussetzt, das sie umstrukturiert.
Das vierte Kapitel behandelt unter dem Titel „Der Zauber von Ganzheit“ die Gestaltpsychologie Kurt Lewins und seiner Nachfolger sowie die Haltung der Phänomenologie zu dieser Richtung. „Ganzheit“ wird gewöhnlich als Gegenbegriff zur technologischen Moderne verstanden. An ihn sind Heilsversprechen gekoppelt, aber auch Irrationalismen. Gegenüber der Diffusität von Ganzheitsforderungen hält Meyer-Drawe mit Blick auf die Schule daran fest, dass die Schülerinnen und Schüler in erster Linie als „epistemische Subjekte“ behandelt werden müssen. Die Schule könnte ein Ort sein, an dem Gedankenspiele zugelassen werden und damit auch die Erfahrung ihres Scheiterns, die schmerzhaft, aber auch produktiv ist. In diesem Sinne könnte sie eine Gegenwelt zur Realität bilden, auf die sie vorbereitet (106). Nach dieser Einleitung wird der Leser mit den gegensätzlichen Positionen der Berliner und der Leipziger Schule der Gestaltpsychologie hinsichtlich der Aufklärbarkeit von Gestalten und Ganzheiten bekannt gemacht (107-111). Der von den Gestaltpsychologen behandelte Gestaltwechsel ist auch Gegenstand phänomenologischer Analysen. Allerdings geht es auf den nachfolgenden Seiten vor allem um die Frage der Leibgebundenheit der Wahrnehmung, weniger um die Frage, wie Gestaltwahrnehmung und ihre Umstrukturierung aus der Sicht der Phänomenologie möglich ist. Ganzheitlichkeit taucht somit als Motiv der Konzeptionalisierung des Wahrnehmungsprozesses wieder auf: Er ist (orientiert man sich mit Meyer-Drawe an Merleau-Ponty) gebunden an den Leib, durch den er hindurchgeht. Das Wahrnehmen kann erst ex-post durch das verständige Denken eingeholt und gegliedert werden. Die Erkenntnis ist an vorprädikative und vorreflexive Akte gebunden, die erst durch die sich nachträglich ihnen zuwendende Akte des Bewusstseins in ihren Leistungen erkannt und anerkannt werden (118).
Das fünfte Kapitel, das mit „Der hochtourige Lerner“ überschrieben ist, hat die Zeitlichkeit des Lernens zum Gegenstand. Zeit ist ein zentrales Thema des Lerndiskurses der Gegenwart. Das Lernen soll einerseits lebenslänglich andauern, darf aber zugleich möglichst wenig Zeit kosten. An die verkürzte Schulzeit schließen sich Kurzstudiengänge an. Zwischen Kinderuni und Juniorprofessur – so darf man wohl ergänzen – ist keine Zeit zu verlieren. Das „eigenaktive“ Kind als „hochtouriger Lerner“ (Elschenbroich) wird zum Ideal einer Gesellschaft, die sich nicht langweilen darf. Meyer-Drawe führt anhand der Diskussion der Zeitexperimente von Benjamin Libet einen Umgang mit der Zeit vor, bei dem die Zeit gemessen und in kleinste Einheiten zerlegt wird und in der es eine Abfolge von Zeitpunkten gibt. Unsere gelebte Zeit ist jedoch anders strukturiert. Da gibt es Lang- und Kurzweiliges; Vergangenheit und Zukunft sind Dinge, die wir nicht anders als in unserer jeweiligen Gegenwart erfahren können (130).
Das Lernen stellt sich nur bei Gelegenheit ein, kann daher nicht erzwungen und auch nicht beschleunigt werden, da wir es nicht im Griff haben, ob die rechte Zeit sich einstellt oder nicht. Beim Lernen stoßen wir auf etwas, das seinen Anfang nicht in uns hat, sondern unsere Aufmerksamkeit auf uns zieht (143). Dies verändert die Sicht auf das Lernen als einer Handlung, die nicht „als Folge einer Entscheidung aufzufassen ist, sondern vielmehr als ein Aufgreifen, als ein Aufgabeln einer Gelegenheit, welche sich uns bietet“ (ebd.). Diese „kairologische Struktur“ des Lernens betrifft auch das Lehren; denn dieses muss den günstigen Moment erkennen und ihn für sich nutzen. Während der dominante Lerndiskurs auf die Zukunft gerichtet ist, also insbesondere auf das, was mittels des Lernens erreicht wird, erinnert die Betrachtung des Anfangs des Lernens an seine Herkunft: an die Dinge, die unsere Antwort herausfordern. Der Anfang des Lernens liegt in einer Störung, einem Widerfahrnis und da man nicht wollen könne, gestört zu werden, könne die Störung auch nicht das Ergebnis eines Entschlusses sein (153). Diese letzte Schlussfolgerung mag man bezweifeln, wo es doch möglich zu sein scheint, auszuziehen, um das fürchten zu lernen, oder – wie Hemingway – in den Krieg zu ziehen, weil zu Hause nichts los ist.
Das im fünften Kapitel angeschlagene Thema wird im nachfolgenden Kapitel unter dem Titel „Der Einspruch der Dinge“ fortgeführt. Gegenüber der Vorstellung, die reale Welt berühre uns Menschen nicht mehr, weil wir selbst Schöpfer unserer Wirklichkeitskonstruktionen seien, hebt Meyer-Drawe als eine zentrale Einsicht der Phänomenologie hervor, dass die Wirklichkeit im Bewusstsein selbst als unabhängig vom Bewusstsein erfahren wird (163). Die Sinnbildung geht nicht vom Bewusstsein aus, sondern dieses reagiert auf die Dinge, die es erfährt. Die Zurückweisung der Ansprüche der Lebenswelt und ihres Erkenntnisstils ist beileibe keine Errungenschaft radikal-konstruktivistischer Ideen. Sie durchzieht die Entwicklung der Wissenschaft, seitdem diese die Natur dem gezielten Experiment aussetzt: Diese hat zu antworten auf die Fragen, die wir ihr stellen, und nicht umgekehrt. Unser Bild der Natur wird mittels der Kategorien des Verstandes entworfen (Kant) und was von der Natur erkannt wird, hängt von der Art und Weise ab, wie wir sie beobachten (Heisenberg). Auch die Phänomenologie Husserls ist von dieser Negierung der Welt nicht ausgenommen, da die Lebenswelt Resultat ihrer vollständigen Aussetzung in der transzendentalen Reduktion ist, nicht aber ihre unhintergehbare Voraussetzung. So ist es eigentlich erst Merleau-Ponty, der die Struktur der Erfahrung als „Reprise“, als innere Wiederaufnahme, wie sich uns die Dinge zeigen, verstanden hat und damit den Dingen den Vorrang vor den Leistungen des Verstandes einräumte.
„Lernen als Erfahrung“ ist nicht nur die Kernthese des Buches, sondern überschreibt auch das letzte Kapitel. In ihm werden die Fäden der vorangehenden Kapitel wieder aufgenommen. Lernen und Erfahren sind Dinge, die uns widerfahren, weil sie uns mit Neuem und Unvorhersehbarem konfrontieren. Es sind die Dinge, die uns belehren. Das Lernen selbst als ein Vollzug bleibt jedoch im Dunkeln, da wir uns erst nachträglich auf das Lernen beziehen können. Klar ist jedoch, dass Lernen als Erfahrung gebunden ist an die Wahrnehmung der Dinge. Erneut geht die Autorin zurück, um im Durchgang durch die antike Philosophie und Geistesgeschichte der Neuzeit zur Phänomenologie als Philosophie der Erfahrung zu gelangen. Nochmals erinnert sie an die Sinnumkehrung neuzeitlicher Wissenschaft, wenn sie hervorhebt, dass unser Erleben uns vertraut, die Hirnströme, die die Wissenschaft misst, jedoch fremd sind (209). Lernen als Erfahrung, ist uns eine vertraute, zugleich dunkle Erscheinung, durch die wir nicht nur etwas über die Sache, sondern vor allem auch etwas über uns selbst erfahren.
Das Verhältnis von Erfahrung und Lernen wirft aber auch Fragen auf: Was unterscheidet Lernen vom Haben bzw. Machen von Erfahrungen? Gibt es nicht Modi des Erfahrens, in deren Folge man weniger weiß als zuvor und es auch nicht mehr wissen möchte? Man könnte auch einen der Fäden des Buches weiterspinnen und die Frage stellen, wie wir etwas über das Lernen und über uns als Lernende erfahren können. In der Logik der von Meyer-Drawe entfalteten Lerntheorie ist dies immer dann der Fall, wenn das Lernen uns herausfordert und mit Unberechenbarem konfrontiert: wenn das Lernen unseren Wünschen Widerstand leistet.
Nicht alles, was Meyer-Drawe schreibt, ist überzeugend, wenn man nicht bereits von der Richtigkeit der phänomenologischen Perspektive überzeugt ist. Ihren Satzkaskaden getreu zu folgen, erschien dem Rezensenten manches Mal als allzu waghalsig. So, wenn die „Doppeldeutigkeit unserer Existenz“ (dem Umstand, dass wir in der Welt sind und uns zugleich intentional zu ihr verhalten) wenige Zeilen später darin mündet, dass wir „nichts anderes sind als das Verhältnis zur Verhältnishaftigkeit von Leibsein und Körperhaben. Wir sind nicht anders als in Zweideutigkeit“ (139). Ist nun der letzte Satz eine Reformulierung des zuvor Gesagten, eine Schlussfolgerung aus ihm oder seine ästhetisierende Übersteigerung?
Zum Schluss ist noch zu hervorzuheben, was genauso gut an den Anfang der Rezension hätte gestellt werden können: Das Buch von Käte Meyer-Drawe ist einfach ein schönes Buch. Man nimmt es gerne in die Hand. Dazu trägt seine Ausstattung durch den Verlag bei, insbesondere die den Kapiteln vorangestellten Abbildungen. In Stil und Inhalt setzt es sich wohltuend von den eilig zusammengeschriebenen Werken ab, die derzeit zum Zwecke einer modularisierten Lehre oder als neueste Kundgaben aus der Wissenschaft von den Verlagen auf den Markt geworfen werden. „Diskurse des Lernens“ ist auch ein literarischer Text und ganz zweifellos ein guter: wissenschaftliche Literatur im besten Wortsinn – auch wenn nicht jede Metapher als geglückt betrachtet werden kann. Denn eine Erkenntnis, „die aus dem Spalt hervorkommt, der sie von der prärationalen Vertrautheit mit Welt trennt“ (117) hat etwas Anrüchiges an sich. Doch es gibt auch die Stellen wie diese: „Um die Welt zu verstehen, darf sie nicht selbstverständlich sein. Bewusstsein von der Welt und Welt selbst bleiben einer vollendeten Synthese beraubt, weil es eines Bruchs mit der Vertrautheit der Welt bedarf, damit ein Bewusstsein von der Welt überhaupt entstehen kann“ (140).
Man muss bereits einiges über Lernen gelesen haben, um den „Diskursen des Lernens“ folgen zu können. Das macht es schwer, dieses Buch als Einstiegslektüre zu empfehlen. Aber es lässt spüren, dass es über die Standardantworten auf Standardfragen hinaus noch etwas zu lernen gibt über das Lernen. Daher sei es vor allem denen empfohlen, die die üblichen Antworten auf die Frage, wie Lernen funktioniert und wie Lernprozesse optimiert werden können, bereits kennen und mit ihnen rundum zufrieden sind.
