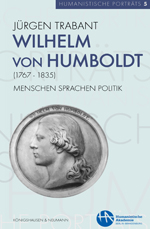 JĂŒrgen Trabant, seit Jahrzehnten mit Interpretationen der sprachwissenschaftlichen und -philosophischen Arbeiten Wilhelm von Humboldts prominent sichtbar (auch mit Sinn fĂŒr das Detail ), prĂ€sentiert in dem jetzt vorgelegten, so schmalen wie konzisen BĂ€ndchen sein Thema in der Reihe âHumanistische PortrĂ€tsâ. Die bereits erschienenen Titel galten Christa Wolf, dem französischen Humanisten und im PlĂ€doyer fĂŒr Toleranz gegen Calvin hervorgetretenen protestantischen Theologen Sebastian Castellio (1515-1563), dem Schriftsteller Heinrich Mann und der SozialpĂ€dagogin Alice Salomon â eine keineswegs alltĂ€gliche, aber sehr inspirierende Liste, wenn man an die StandarderzĂ€hlungen von âHumanistenâ denkt. Wie passt Humboldt in diese Reihe? Kann man ihn zu den Personen rechnen, die â wie die Reihenherausgeber aus der âHumanistischen Akademieâ ihr Programm in einem Vorwort erlĂ€utern â âgezeigt haben, dass ohne HumanitĂ€t Humanismus nicht zu machen istâ, die âdurch ihr Leben, ihr Reden, Schreiben, Handeln âMenschlichkeitâ, âBildung und Barmherzigkeitâ bewiesen, den Menschen âin die Mitteâ gestellt habenâ, die Menschen sind, die auch ââBildungâ nicht als Privilegâ verstehen? Dabei, das beruhigt den angesichts derart geballter PositivitĂ€t etwas beunruhigten Leser, soll das PortrĂ€t âkeine Heiligengeschichteâ darstellen, âsondern [âŠ] anschauliche Charakteristikâ, âIrrwege und Missbrauch, Scheitern und Fehlentwicklungâ nicht ausschlieĂen.
JĂŒrgen Trabant, seit Jahrzehnten mit Interpretationen der sprachwissenschaftlichen und -philosophischen Arbeiten Wilhelm von Humboldts prominent sichtbar (auch mit Sinn fĂŒr das Detail ), prĂ€sentiert in dem jetzt vorgelegten, so schmalen wie konzisen BĂ€ndchen sein Thema in der Reihe âHumanistische PortrĂ€tsâ. Die bereits erschienenen Titel galten Christa Wolf, dem französischen Humanisten und im PlĂ€doyer fĂŒr Toleranz gegen Calvin hervorgetretenen protestantischen Theologen Sebastian Castellio (1515-1563), dem Schriftsteller Heinrich Mann und der SozialpĂ€dagogin Alice Salomon â eine keineswegs alltĂ€gliche, aber sehr inspirierende Liste, wenn man an die StandarderzĂ€hlungen von âHumanistenâ denkt. Wie passt Humboldt in diese Reihe? Kann man ihn zu den Personen rechnen, die â wie die Reihenherausgeber aus der âHumanistischen Akademieâ ihr Programm in einem Vorwort erlĂ€utern â âgezeigt haben, dass ohne HumanitĂ€t Humanismus nicht zu machen istâ, die âdurch ihr Leben, ihr Reden, Schreiben, Handeln âMenschlichkeitâ, âBildung und Barmherzigkeitâ bewiesen, den Menschen âin die Mitteâ gestellt habenâ, die Menschen sind, die auch ââBildungâ nicht als Privilegâ verstehen? Dabei, das beruhigt den angesichts derart geballter PositivitĂ€t etwas beunruhigten Leser, soll das PortrĂ€t âkeine Heiligengeschichteâ darstellen, âsondern [âŠ] anschauliche Charakteristikâ, âIrrwege und Missbrauch, Scheitern und Fehlentwicklungâ nicht ausschlieĂen.
Trabant deutet im Untertitel an, in welchen Referenzen er den Humanisten Humboldt identifizieren will: âMenschen Sprachen Politikâ. Der Text prĂ€sentiert das in fĂŒnf Kapiteln: Mit einer âPortrĂ€t-Skizzeâ (1.) zuerst, der (2.) âBewegungenâ folgen, nicht etwa soziale, sondern Humboldts eigene Bildungsbewegungen âauf der Suche nach der Wissenschaft vom Menschenâ. In Kap. 3 folgen âMissionen: der Staatsmannâ, mit der politischen Agenda, fĂŒr die Humboldt sich in PreuĂen mehr oder weniger erfolgreich von der Bildungspolitik ĂŒber Verfassungsfragen bis zur MuseumsgrĂŒndung engagiert hat. Das PortrĂ€t mĂŒndet (4.) in âAnkunft: Die Spracheâ, und hier sieht man, dass der Sprachtheoretiker Trabant die Summe dieses Lebens doch sprachphilosophisch zusammenfasst, bis in das âFazitâ, und dann (5.) kommt der Bruder â⊠und Alexanderâ. Erfreut notiert man jedenfalls schon hier, dass der âNeuhumanismusâ, auf den die PĂ€dagogen Humboldt gern reduzieren, keinen systematischen Gliederungspunkt liefert.
Ăberzeugt das PortrĂ€t auch im Detail? Trabant hat fĂŒr die âCharakteristikâ seines Helden (um Humboldts eigene Qualifizierung der Gattung zu benutzen) kaum mehr als 80 Seiten zur VerfĂŒgung, Literaturangaben, Endnoten und eine Bibliographie der zu Lebzeiten publizierten Schriften Humboldts fĂŒllen den Rest â nicht neue Forschung, ihre reflektierte Pointierung bestimmt die Argumentation. Die einleitende âPortrĂ€t-Skizzeâ gibt eine knappe Ăbersicht, keine Diskussion der internationalen Forschung, resĂŒmiert die wichtigsten Etappen des Lebenslaufs, der von Tegel in die Welt â der Bildung, der Politik, der Wissenschaft â und zurĂŒck nach Tegel fĂŒhrt (Göttingen als Studienort ist etwas knapp prĂ€sent, Blumenbach z.B. und der âBildungstriebâ fehlen ganz), und hebt, selbst immer noch ĂŒberrascht von dieser Beobachtung des Germanisten Ernst Osterkamp , die Tatsache hervor, dass Humboldts Leben und Werk ein âNachlassphĂ€nomenâ darstellen. Das gelte einerseits, weil er in der Wahrnehmung wesentlich in Texten und Korrespondenzen existiere, die zu seinen Lebzeiten öffentlich nicht prĂ€sent waren, und andererseits, weil sich das Bild von Leben und Werk, auch vom (universitĂ€tsbezogenen) Mythos Humboldts erst in der nachgehenden Rekonstruktion formt, also vom Nachruf Boeckhs 1835 bis zu Trabants Deutung 2021.Trabant konstruiert den Lebenslauf als Bildungsprozess und die individuelle Praxis triadisch: âBewegungenâ, âMissionenâ âAnkunftâ.
In den Bewegungen zeigt er, humboldtianisch und bildungstheoretisch gedacht, wie sich die IndividualitĂ€t in âWechselwirkungâ mit diversen Welten konstituiert: zuerst mit personalen Welten, im GesprĂ€ch v.a. mit Schiller, âder einzige Mann, den ich auf dieser Erde sehr geliebt habeâ, und Goethe, als Initiation in Dichtung und Philosophie (er liest mit Schiller Kant), dann mit Kulturen, natĂŒrlich âdas Griechischeâ, endlich mit der Differenz und Gemeinsamkeit der Geschlechter. Und da liefert Trabant in der sprachphilosophischen Interpretation von Humboldts Ehrenrettung fĂŒr den âAusdruck: FreudenmĂ€dchenâ (23) eine unterhaltsam-bildendem gelehrte Trouvaille. Gegen aufklĂ€rerische Moralapostel wird das Wort neu gelesen, von der Freude aus, die der SexualitĂ€t eigen ist, und zugleich zeigt Trabant die groĂe Bedeutung der SexualitĂ€t fĂŒr Humboldt, den fĂŒr ihn zwingenden Zusammenhang von Sinnlichkeit, SexualitĂ€t und Geist, schon âprĂ€freudianischâ (26), bis hin zum Aufweis der Differenz und Gemeinsamkeit der Geschlechter, die Humboldts Geschlechterphilosophie in der Synthese von TraditionalitĂ€t und ModernitĂ€t luzide demonstriert. Die Bildungsreisen nach Paris, zu den Basken und nach Rom, nicht zufĂ€llig jĂŒngst als ethnologische Forschungsreisen interpretiert, runden die Bewegungen ab. Die staatsmĂ€nnischen âMissionenâ leben vom Ertrag dieser âBewegungenâ, denn Humboldt ist ein âMann des Zupackensâ geworden, der zudem politische Probleme in klaren Texten âglĂ€nzend formulierenâ kann (44). Das beweist er bildungspolitisch in PreuĂen, wo er, seine bekannteste âMissionâ, 1809/10 âein kohĂ€rentes Erziehungssystemâ, eingeschlossen die âPrinzipien einer Idealen UniversitĂ€tâ konzipiert; aber âschaffenâ (43), wie Trabant formuliert, ist zu stark, weil es die Realisierungsfriktionen ausblendet. Er agiert hier auch sehr wohl in der Linie seiner frĂŒhen liberalen Staatstheorie, wie die zu Recht, auch gegen den dĂŒmmlichen aktuellen Vorwurf des Antisemitismus bei Humboldt, stark akzentuierte Stellungnahme von 1810 zur âKonstitution ĂŒber die Judenâ belegt.
Die Differenz von Entwurf und Scheitern zeigt sich allerdings deutlich in Verfassungsfragen, die 1819 zu seinem RĂŒckzug nach Tegel fĂŒhren â aber hier wĂŒrde ich, âNachlassphĂ€nomenâ! â die Wirkungsgeschichte des liberalen Theoretikers Humboldt stĂ€rker als Trabant akzentuieren, die ja schon, international, mit John Stuart Mills âOn Libertyâ l859 einsetzt. In Bildungsfragen ist er 1829/30 noch einmal erfolgreich, wenn er das Museum im Lustgarten als Ort der âĂ€sthetischen Erziehung des Volkesâ (59) begrĂŒnden kann.
Ihr Ziel findet diese Biographie, âAnkunftâ ist Trabants These, in Humboldts Arbeit an der Sprache. Hier kommt auch der Humanist zur Vollendung: denn âDer Mensch ist nur Mensch in der Spracheâ (14, 39). Das âFazitâ stilisiert die These noch stĂ€rker, denn es ist âdie Idee der Sprache, die sich in Wilhelm von Humboldt offenbartâ (86). Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie, Bildungsprozesse und der Umgang mit Welt kommen in seinem Modell von Sprache, einer Wirklichkeit jenseits der TrivialitĂ€t von Kommunikation und dem Gebrauch relativ beliebiger Zeichen, zur Einheit einer eigenen Welt, die als âArbeit des Geistesâ und der ReprĂ€sentation von âWeltansichtenâ auch die Einheit von Anthropos und Kosmos stiftet, also in der Symbiose, WĂŒrde und Anerkennung diverser Welten, fĂŒr die Wilhelm und Alexander stehen, als Humanisten. Trabant hat auch dafĂŒr den ĂŒberzeugenden Beleg, wenn er sein PortrĂ€t mit einem Zitat aus Alexanders âKosmosâ-Vorlesungen schlieĂt, der seinen Bruder Wilhelm mit âihrer gemeinsamen kosmo-politischen Botschaftâ (Trabant) zu Wort kommen lĂ€sst: Sie suchen, so wird Wilhelm von Alexander zitiert, als âIdeeâ der Geschichte die âMenschlichkeitâ, das Bestreben, die Menschheit âohne RĂŒcksicht auf Religion, Nation und Farbeâ als âverbrĂŒderten Stammâ zu sehen, vereint in der Arbeit an der âVervollkommnungâ des âganzen Geschlechtsâ (88). Ohne Zweifel, man muss Trabants âGemĂ€ldeâ studieren, um Humboldts âCharakterâ als den eines âHumanistenâ zu verstehen.
(1) JĂŒngster Beleg dafĂŒr sind seine BeitrĂ€ge in P. Spies/U. Tintemann/J. Mende (Hg.) (2020): Wilhelm und Alexander von Humboldt. Berliner Kosmos. Köln: Wienand. Dort findet man einen Essay ĂŒber âDie BrĂŒder Wilhelm und Alexander von Humboldtâ (S. 11-17), den man ergĂ€nzend zu der sehr knappen Skizze in Kap. 5 lesen sollte, und Texte, die den jeweiligen âKosmosâ in der Einheit von MaterialitĂ€t und Theorie beschreiben: âSprachphilosophie â der Schreibtischâ (123-127), âAmerika â das Wörterbuchâ (129-131), âĂbersetzen â das Griechischeâ (161-163).
(2) Trabant beruft sich auf E. Osterkamp: Gesamtbildung und freier Genuss. In: J. Trabant (Hg.) (2018): Wilhelm von Humboldt: Sprache, Dichtung und Geschichte. Paderborn: Fink, 57-79 (Trabant zitiert den Titel etwas unvollstÀndig, so dass er wie eine Monographie aussieht. Es ist aber die von ihm edierte Dokumentation des Symposions der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften anlÀsslich von Humboldts 250. Geburtstag).
(3) So R. Mattig (2019): Wilhelm von Humboldt als Ethnograph. Bildungsforschung im Zeitalter der AufklÀrung. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
