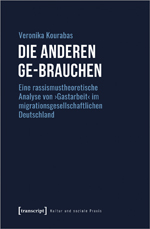 Die Dissertationsstudie von Veronika Kourabas ist höchst aktuell: Einerseits aufgrund der aktuellen, deutschlandweiten Thematisierung und des Zelebrierens der âAnwerbeabkommenâ mit LĂ€ndern wie der TĂŒrkei im Jahr 1961, andererseits aufgrund bestehender Ressentiments in Deutschland gegenĂŒber Menschen mit einer Migrationsbiografie. Hierbei sind PhĂ€nomene zu beobachten, wie zum Beispiel die kulturalisierende ReprĂ€sentation sowie Zugehörigkeitskonstruktion von Gastarbeiter:innen und Migrant:innen. Kourabas verortet in ihrer Studie Gastarbeit âzeitgeschichtlichâ (293) und analysiert âGastarbeitâ dabei âaus einer rassismustheoretischen Perspektive als Ge-BrauchsverhĂ€ltnis gastarbeitender Anderer im migrationsgesellschaftlichen Deutschlandâ (293). Kourabas zielt mit ihrer Arbeit darauf ab, die Aspekte, die âGastarbeitâ als ein MachtverhĂ€ltnis charakterisieren âin rassismustheoretischer Perspektive herauszuarbeiten und von Formen des Ver-Brauchs rassifizierter Anderer abzugrenzenâ (20).
Die Dissertationsstudie von Veronika Kourabas ist höchst aktuell: Einerseits aufgrund der aktuellen, deutschlandweiten Thematisierung und des Zelebrierens der âAnwerbeabkommenâ mit LĂ€ndern wie der TĂŒrkei im Jahr 1961, andererseits aufgrund bestehender Ressentiments in Deutschland gegenĂŒber Menschen mit einer Migrationsbiografie. Hierbei sind PhĂ€nomene zu beobachten, wie zum Beispiel die kulturalisierende ReprĂ€sentation sowie Zugehörigkeitskonstruktion von Gastarbeiter:innen und Migrant:innen. Kourabas verortet in ihrer Studie Gastarbeit âzeitgeschichtlichâ (293) und analysiert âGastarbeitâ dabei âaus einer rassismustheoretischen Perspektive als Ge-BrauchsverhĂ€ltnis gastarbeitender Anderer im migrationsgesellschaftlichen Deutschlandâ (293). Kourabas zielt mit ihrer Arbeit darauf ab, die Aspekte, die âGastarbeitâ als ein MachtverhĂ€ltnis charakterisieren âin rassismustheoretischer Perspektive herauszuarbeiten und von Formen des Ver-Brauchs rassifizierter Anderer abzugrenzenâ (20).
Kourabas leitet ihre Arbeit mit einem historischen Bild aus der MĂŒnchner Illustrierten von 1960 ein: âFĂŒr 60 Mark einen Italienerâ (14). Mit dieser historischen Kontextualisierung wendet Kourabas ihre rassismustheoretische Perspektive auf die âgesellschaftliche Diskursstrukturâ (23) der âGastarbeitâ an. Die Studie gliedert sich dabei in vier ĂŒbergeordnete Kapitel.
In Kapitel 2 Wann war âGastarbeitâ? Erinnerung und Zeitgeschichte nĂ€hert sich Kourabas âGastarbeitâ aus einer zeitgeschichtlichen und erinnerungsbezogenen Perspektive. Hierzu diskutiert sie Begriffe und Bezeichnungen wie âGastarbeitâ, âfremdlĂ€ndische ArbeitskrĂ€fteâ sowie âFremdarbeiter_inâ (50). Auch werden Orte und geographische Komponenten wie âGastarbeiterlagerâ (50) kritisch aufgegriffen. Kourabas scharfe Analyse der berĂŒhmten Abbildung der Beschenkung des einmillionsten Gastarbeiters Armando Rodrigues de SĂĄ mit einem Moped, erlaubt diese migrationshistorische Szene neu zu sehen. In ihrer Studie geht Kourabas davon aus, dass Gastarbeiter:innen als eine Gruppe von migrantischen Anderen verstanden werden, die nicht zugehörige und legitim anwesende Personen in der natio-ethno-kulturellen Ordnung der Zugehörigkeit in Deutschland sind (18). Kourabas erlaubt mit diesem Kapitel eine neue Lesart der Narration der Arbeitsmigration in Verflochtenheit von Vergangenem und GegenwĂ€rtigen (siehe auch ihre âExemplarische Fallstudie: Alte und neue Gastarbeitâ, 54).
In Kapitel 3 Deutschland unter rassismustheoretischer Perspektive wird âRassismus als ein umfassendes, da gesellschaftsstrukturierendes und gesellschaftsstrukturiertes VerhĂ€ltnis expliziertâ (73). Kourabas diskutiert mit einem diskurstheoretischen Zugang zu Rassismus, den Ein- und Ausschluss Migrationsanderer als differentialistischen Rassismus. Das differentialistische RassismusverstĂ€ndnis wird weiter fortgefĂŒhrt in ihrer Analyse zu Rassismus und Kapitalismus (98), Rassismus und KlassenverhĂ€ltnisse (102), Rassismus und GeschlechterverhĂ€ltnisse (114) sowie (un-)sichtbare Arbeit und Körper in verwobenen MachtverhĂ€ltnissen (120). Die Autorin geht dabei u.a. auf die ââVermĂ€nnlichungâ von Migrationsbewegungenâ ein, welche als âAusdruck einer androzentristischen Universalisierungsstrategie verstanden werden kann, die wiederum fĂŒr Geschlechterdiskurse als auch rassismusrelevantes Wissen symptomatisch istâ (117).
In Kapitel 4 verfolgt Kourabas das Ziel der âTheoretisierung von Rassismus als Ge-Brauchs und Ver-BrauchsverhĂ€ltnisâ (127). Sie veranschaulicht anhand von Darstellungen und Analysen die begrifflich orientierte Heuristik âvon Brauchen, Ver-Brauchen und Ge-Brauchenâ (168). So stellt die Autorin zum Beispiel in ihrem Konzept fest, dass der ârassifizierte Andereâ im Kontext des Ver-brauchsverhĂ€ltnisses in einem solchen AusmaĂ entmenschlicht und verdinglicht wird, dass seine_ihre SubjektivitĂ€t vollstĂ€ndig verbraucht â oder aufgebraucht wird. Anhand dieser Analysen zeigt Kourabas, dass âdas Brauchenâ (166), âdas Ver-Brauchenâ (172) sowie âdas Ge-Brauchenâ (177), ânicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern aufgrund rassifizierter (Ab-)Spaltungen und Double-Bind Konstruktionen miteinander verstrickt und aufeinander verwiesen sindâ (295). Hier lehnt sich Kourabas methodologisch an die Begriffe âFigur und Paradigmaâ (Giorgio Agamben und Michel Foucault) an, um âGe-Brauch als paradigmatische Bezugnahme auf rassifizierte Andere im Zuge instrumenteller Nutzungsbewegungenâ (295) zu konkretisieren. So rekonstruiert Kourabas âGe-Brauch als eine Form materieller sowie symbolisch-diskursiver Ein- und AusschlĂŒsse gastarbeitender Andererâ (295) am Beispiel der Figur âGastarbeitâ.
In Kapitel 5 Rassismustheoretische Analyse von âGastarbeitâ als Ge-BrauchsverhĂ€ltnis diskutiert Kourabas den materialisierten Ge-Brauch gastarbeitender Anderer als rassifizierte Arbeitskraft. Differenziert setzt sich Kourabas mit âGastarbeit als rassistisches, kapitalistisches, vergeschlechtliches und klassenbezogenes Zusammenspielâ auseinander (191). Sie verdeutlicht âein komplexes Verflechtungsfeld von Macht und WiderstĂ€ndigkeit im migrationsgesellschaftlichen Raum Deutschlandâ hinsichtlich der âEin- und AusschlĂŒsse im Zuge des Ge-Brauchs gastarbeitender Andererâ, wie auch âdas Ergreifen sowie praktische und taktische Ausgestalten von HandlungsspielrĂ€umen und Eigensinnigkeitâ (295).
In ihrer Schlussbetrachtung resĂŒmiert Kourabas âRassismus als mehrfache Verlustbeziehung und -geschichteâ (298) und reflektiert fundiert damit auch die Verlustgeschichte temporĂ€rer und prekĂ€rer Zugehörigkeit gastarbeitender Anderer, indem sie festhĂ€lt: âEntgegen der Fiktion einer temporĂ€ren und prekĂ€ren Zugehörigkeit als âarbeitende GĂ€steâ haben sich gastarbeitende Andere nicht nur sozialrĂ€umlich, sondern auch personell sowie symbolisch-diskursiv in Deutschland niedergelassen und seine migrationsgesellschaftliche Vergangenheit wie Gegenwart als Akteur_innen mitgestaltetâ (301). In ihrer zusammenfassenden Reflexion merkt die Autorin an, dass ihre Studie und die Herausarbeitung der historisch-spezifischen Figur Gastarbeit âauf ĂŒbergreifender Ebene als eine Theoretisierung auf dem Weg zu einer Theorie des Ge-Brauchs in von Rassismus strukturierten MachtverhĂ€ltnissenâ (302) verstanden werden kann. Zum Schluss formuliert Kourabas Umgangsweisen fĂŒr eine rassismuskritisch geschĂ€rfte PĂ€dagogik, die es auszuarbeiten und anzuwenden gilt.
Kourabas Dissertation bietet fĂŒr Wissenschaftler:innen mit einem Forschungsinteresse zu Gastarbeit, Rassismus, Migration und auch Flucht neue Erkenntnisse fĂŒr die migrationsgesellschaftliche RealitĂ€t in Deutschland. Die heuristischen Konzepte Ge-Brauch sowie Ver-Brauch, welche die Autorin in ihrer rassismustheoretischen Analyse entwickelt hat, bieten Transferpotenzial fĂŒr weitere Formen ge- oder verbrauchender BezĂŒge auf rassifizierte Andere, zum Beispiel âUngleichheitstraditionen in bildungsrelevanten Institutionenâ (297). Die Arbeit beinhaltet, neben der Relevanz fĂŒr die erziehungswissenschaftliche Migrations- und Rassismusforschung, auch Potenzial fĂŒr den Lehrkontext: hier wĂŒrde sich die Studie als hervorragende Literatur fĂŒr Lehrende mit einem Fokus im Bereich rassismuskritische PĂ€dagogik fĂŒr postgraduale StudiengĂ€nge anbieten.
Die Arbeit von Kourabas kann als ein sehr wichtiger Beitrag und eine essenzielle Stimme zu der Thematik âGastarbeitâ in Deutschland eingeordnet werden. Der Autorin gelingt es mit ihrer interdisziplinĂ€ren Analyse, sowohl unter Einbezug einer âmigrationspĂ€dagogischen und rassismustheoretischen Perspektiveâ (21) als auch ĂŒber postkoloniale und subjektivierungstheoretische ZugĂ€nge, einen wichtigen Beitrag auf Fragen, wie sich âGastarbeitâ in zeitgeschichtlicher Perspektive konstituiert und wie das VerhĂ€ltnis zwischen dominanzkulturellem Wir und gastarbeitenden Anderen modelliert werden kann, hervorzubringen. Kourabas zeigt treffend, dass die Episode âGastarbeitâ im migrationsgesellschaftlichen Raum Deutschland nicht abgeschlossen ist. Mit ihrer umfassenden Studie gelingt es ihr, Historie und Gegenwart aus interdisziplinĂ€rer Sicht zu vernetzen, sowie âGastarbeitâ neu zu denken.
