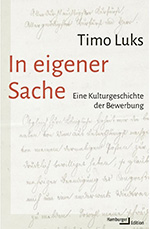 Die Herausbildung einer auf meritokratischen Prinzipien gründenden Gesellschaft seit der Sattelzeit um 1800 wurde in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus historischer Studien gerückt, insbesondere erfuhr die gesellschaftliche Formierung der Leistungsorientierung vermehrte Aufmerksamkeit [1]. Die „Kulturgeschichte der Bewerbung“ des Historikers Timo Luks reiht sich unmittelbar in diesen Forschungskontext ein. Seine Studie betrachtet, wie sich die Bewerbung im 19. Jahrhundert von einer Bittschrift hin zu einer Darstellung individueller Leistungsfähigkeit und -bereitschaft gewandelt hat. Die Bewerbung sei dabei – so Luks Hauptthese – zu einer zentralen Kulturtechnik der modernen Arbeitsgesellschaft aufgestiegen. Indem die Bewerbung als frühe Form der Arbeit am Selbst analysiert wird, bildet die Studie auch eine differenzierte Vorgeschichte zu den arbeits- und industriesoziologischen Studien der Subjektivierung des Selbst, der Individualisierung und Ökonomisierung von Arbeitsbeziehungen und den entsprechenden Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung [2].
Die Herausbildung einer auf meritokratischen Prinzipien gründenden Gesellschaft seit der Sattelzeit um 1800 wurde in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus historischer Studien gerückt, insbesondere erfuhr die gesellschaftliche Formierung der Leistungsorientierung vermehrte Aufmerksamkeit [1]. Die „Kulturgeschichte der Bewerbung“ des Historikers Timo Luks reiht sich unmittelbar in diesen Forschungskontext ein. Seine Studie betrachtet, wie sich die Bewerbung im 19. Jahrhundert von einer Bittschrift hin zu einer Darstellung individueller Leistungsfähigkeit und -bereitschaft gewandelt hat. Die Bewerbung sei dabei – so Luks Hauptthese – zu einer zentralen Kulturtechnik der modernen Arbeitsgesellschaft aufgestiegen. Indem die Bewerbung als frühe Form der Arbeit am Selbst analysiert wird, bildet die Studie auch eine differenzierte Vorgeschichte zu den arbeits- und industriesoziologischen Studien der Subjektivierung des Selbst, der Individualisierung und Ökonomisierung von Arbeitsbeziehungen und den entsprechenden Veränderungen in der Aus- und Weiterbildung [2].
Luks betrachtet den Zeitraum zwischen dem späten 18. und frühen 20. Jahrhundert. Als Quellen dienen die in dieser Zeitspanne breit verfügbare Ratgeberliteratur zu Bewerbungsschreiben wie auch archivalisch überlieferte Bewerbungsdossiers aus unterschiedlichen Beschäftigungssegmenten. Dabei zeigt sich, wie sich die Bewerbungstechnik aus gesellschaftlichen Vorstellungen von Patronage und sittlicher Ökonomie herausgelöst hat. Statt in Form von Bittgesuchen Bedürftigkeit zu signalisieren, folgten Bewerbungen immer deutlicher meritokratischen Vorstellungen, denen zufolge der Zuschlag für eine Arbeitsstelle auf Qualifikation und Eignung zurückgeführt und als Zeichen individuellen Erfolgs gewertet wurde.
Nach einer begriffsgeschichtlich perspektivierten Einleitung gibt der Autor zunächst einen Überblick über den Wandel von Bewerbungen auf der Basis der normativen Gattung «Bewerbungsratgeber». Im Hauptteil führt Luks chronologisch entlang von sechs Kapiteln durch seine umfassende Quellenrecherche. Die Hauptkapitel werden geschickt unterbrochen durch fünf Zwischenstücke, in denen interessante Quellenfunde wie die Bewerbung von Prominenten – z.B. Jacob Grimms Bewerbung als Privatbibliothekar im frühen 19. Jahrhundert – oder umfassendere Dokumentationen zu einzelnen Bewerbungsverfahren ausführlicher ausgebreitet werden.
Für die erste Hälfte des Untersuchungszeitraums zeigt der Autor, wie Bewerbungsschreiben vor allem auf die Darstellung von Bedürftigkeit ausgerichtet waren, indem persönliche Schicksalsschläge, prekäre finanzielle Verhältnisse, das Ausscheiden aus dem Militärdienst oder die familiären Verhältnisse dargelegt wurden, um eine Arbeitsstelle zu erlangen. Die Gesuche waren – oft in ausschweifender Form – erzählend angelegt, im Duktus von Bittgesuchen verfasst und vermittelten eine Unterwürfigkeit gegenüber den Adressaten, auf deren Wohlwollen die Bewerber angewiesen waren. Nicht selten waren Insiderkenntnisse, so zum Beispiel das Wissen über den Tod des vorherigen Stelleninhabers, ausschlaggebend für die Bewerbung. Und aus heutiger Sicht ist erstaunlich, wie oft auch Erfolglosigkeit oder Scheitern der Bewerber thematisiert wurden.
Bereits im frühen 19. Jahrhundert zeichnete sich indes ab, dass die Bewerbungspraktiken für höhere Berufe moderne Formen annahmen. Bewerbungsschreiben von Kaufmännern zielten auf einen nächsten Karriereschritt in ein ökonomisch stärkeres oder internationaleres Umfeld und folgten in ihren Erzählungen einer linearen Berufsaufstiegsgeschichte. In Bewerbungen für Verwaltungsstellen finden sich erste Formen eines geordneten Lebenslaufs, wenngleich noch nicht in tabellarischer Form, und eine systematischere Verschränkung von Karrierewünschen und Karrierechancen. Ebenso hielten formalisierte Leistungsbeurteilungen Einzug in die Bewerbungsprozesse – noch bevor im Schulwesen standardisierte Noten etabliert wurden –, zunächst im Zulassungsdienst von Staatsangestellten.
In einem eigenen Kapitel widmet sich Luks den Bewerberinnen, die in den Ratgebern kaum angesprochen – lediglich für die Stelle einer Erzieherin ist ein Musteranstellungsgesuch erwähnt – und in den recherchierten Dossiers wenig repräsentiert waren. Umso lobenswerter ist es, dass der Autor trotz dieser Ausgangslage herausarbeiten kann, wie stark die Bewerbungsschreiben von Frauen auf deren Ehemänner bezogen waren, die – seien sie verwitwet, verunfallt oder anderweitig vom Schicksal getroffen – selbst nicht arbeitstätig waren.
Für die Zeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts kann Luks facettenreich zeigen, wie die Bewerbung zunehmend formalisiert und standardisiert wurde. Damit einher ging auch eine stärkere Orientierung an Vergleichbarkeit und Konkurrenz zwischen den Bewerbern. Wenn mehrere Bewerbungen von derselben Person überliefert sind, weist Luks auf Lerneffekte des Bewerbers hin, der in seinen Gesuchen immer deutlicher auf die Nennung von Schicksalsschlägen und den Ausdruck von Bedürftigkeit verzichtete. Die Wettbewerbssituation bei der Bewerbung wurde deutlicher und bisweilen explizit adressiert, indem vermehrt auf standardisierte Leistungsindikatoren verwiesen wurde. Zu diesen zählten allerdings weiterhin weniger Schulnoten, sondern vielmehr andere Vorprüfungen für den Staatsdienst. Den Ausschreibungen wurde mehr Bedeutung zugewiesen, indem die darin genannten Kriterien und Anforderungen explizit in den Anschreiben aufgegriffen wurden. Und schließlich orientierten sich die Bewerbungsschreiben stärker chronologisch entlang von Bildung und bisheriger Beschäftigung. Dies führte zu einer Differenzierung des Bewerbungsdossiers mit immer kürzer werdenden Anschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen als Beilagen.
Bei der Betrachtung des späten 19. Jahrhundert nimmt die Studie auch den Umgang der Rekrutierenden mit den Bewerbungen in den Blick. Anschreiben, Anstellungsgesuche und Auswahl der Bewerber wurden systematischer aufeinander bezogen. Die weiter zunehmende Standardisierung und Formalisierung der Bewerbungen, die sich in einer expliziten Bezugnahme auf Anstellungskriterien und in dem sich durchsetzenden Format des tabellarischen Lebenslaufs abbilden, führte auf der Gegenseite zu einer kriteriengeleiteten Beurteilung und Gegenüberstellung der Bewerber, die sich in den Quellen ebenfalls in tabellarischer Form zeigt. Arbeitsmarktbezogene Rekrutierungsstrategien der Unternehmen sowie das Aufkommen von Einrichtungen der Berufsberatung schlossen unmittelbar an diese Entwicklung an. Ein Effekt war, dass sich im Zuge dessen die Figur des Bewerbers stabilisierte und sich die Bewerbung als individuelles Problem des Bewerbers etablierte. Dies bildet denn auch den letzten Schritt in Luks’ Argumentation des Aufstiegs der Kulturtechnik der Bewerbung zu einer der zentralen arbeitsbezogenen Techniken des Selbst.
Die quellengesättigte Studie besticht durch Detailreichtum und klare Argumentation. Das Buch liest sich sehr flüssig, die relevanten Kontexte werden gegenstandsangemessen dargelegt und unterstützen das Verständnis der jeweiligen Untersuchungseinheiten. Allerdings sind die einzelnen Unterkapitel unterschiedlich stark strukturiert und verdichtet, einige sind stärker quellengesättigt-narrativ, andere – gerade, wenn eine Vielzahl von Quellen herangezogen werden konnte – deutlicher systematisierend angelegt. Dies mag auch der unterschiedlichen Quellenlage geschuldet sein.
Überzeugend sind die Strukturierung der Hauptkapitel entlang der Segmentierung der Arbeitswelt und die damit einhergehenden differenzierten Analysen einer ungleichzeitigen Entwicklung der Bewerbungstechniken. Daran anknüpfend lässt sich allerdings fragen, ob durch eine noch explizitere Systematisierung der Effekte der Segmentierung der Arbeitswelt auf das Bewerbungswesen die sozialstrukturierende Dimension dieser Entwicklungslinien noch offensiver in die Analyse hätte eingebunden werden können. Nichtsdestotrotz liest sich die Studie auch aus bildungshistorischer Perspektive mit großem Gewinn. Der Aufstieg der Bewerbung zu einer arbeitsbezogenen Technik des Selbst ist ein relevanter Teilaspekt der historischen Entwicklungen der Berufs- und Weiterbildung und der Berufsberatung.
[1] Vgl. z.B. Verheyen, N. (2018). Die Erfindung der Leistung. Hanser.
[2] Vgl. z.B. Voß, G. G., & Pongratz, H. J. (1998). Der Arbeitskraftunternehmer: Eine neue Grundform der „Ware Arbeitskraft“? Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50, 131–158.
Bröckling, U. (2007). Das unternehmerische Selbst. Suhrkamp.
Baethge, M., & Baethge-Kinsky, V. (1998). Jenseits von Beruf und Beruflichkeit? Neue Formen von Arbeitsorganisation und Beschäftigung und ihre Bedeutung für eine zentrale Kategorie gesellschaftlicher Integration. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 31, 461–472.
